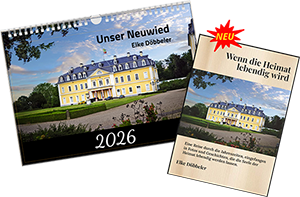27.10.2025 | Generalstaatsanwaltschaft Koblenz
Generalstaatsanwaltschaft Koblenz bestätigt Einstellungsentscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz
Mit Verfügungen vom 17.04.2024 hat die Staatsanwaltschaft Koblenz den von ihr geführten Ermittlungskomplex wegen möglicher strafrechtlich relevanter Versäumnisse bei der Bewältigung der Ahrflut am 14./15.07.2021 gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Die hiergegen erhobenen Beschwerden hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz nunmehr mit Verfügungen vom 15.10.2025 zurückgewiesen. Hierfür waren zusammengefasst folgende Gründe maßgeblich:
I. Vorrangige Fragestellungen
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz sind vorrangig auf die Beantwortung folgender Fragestellungen gerichtet gewesen:
1.
Gab es vor dem Flutgeschehen ausreichende Hinweise, die aus strafrechtlicher Sicht eine andere Vorbereitung auf das Geschehen erfordert hätten, und hätte eine solche andere Vorbereitung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die entstandenen Todesfälle und Verletzungen vollständig oder teilweise verhindert?
2.
Gab es während des Flutgeschehens einen für die Beschuldigten erkennbaren Zeitpunkt, zu dem sie anders als geschehen hätten handeln müssen und können, und hätten diese anderen Handlungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die entstandenen Todesfälle und Verletzungen vollständig oder teilweise verhindert?
3.
Ein besonderes Augenmerk der Ermittlungen lag von Anbeginn der Ermittlungen auf dem Tod von zwölf Bewohnern einer Einrichtung der Lebenshilfe in Sinzig. Grund hierfür war die Annahme, dass bei diesen durch die Flut getöteten Menschen davon auszugehen gewesen wäre, dass ihr Betreuer behördlichen Warnungen Folge geleistet hätte.
II. Rechtliche Gesichtspunkte
Rechtlicher Ausgangspunkt sind die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung im Amt, jeweils begangen durch ein Unterlassen.
Fahrlässigkeit bedeutet - verkürzt dargestellt - die Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt. Kommt eine Tatbegehung durch Unterlassen in Betracht, muss der Täter eine bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erforderliche Handlung, zu der er verpflichtet gewesen ist, unterlassen haben. Um den Tatbestand zu erfüllen, muss dieses Unterlassen den sogenannten Tatbestandserfolg - hier die Tötung und Verletzung von Menschen - verursacht haben.
Das deutsche Strafrecht verlangt für Bestrafungen das Vorliegen einer Schuld. Nur wem eine solche Schuld nachgewiesen werden kann, kann ggf. bestraft werden. Die Beurteilung der Pflichtverletzung knüpft daher bei einer Unterlassungsstraftat daran an, welche Vorstellungen von bestehenden Handlungspflichten der Täter gehabt hat oder hätte haben müssen.
Erkennt der Täter die Unzulänglichkeit seiner Maßnahmen und trifft daraufhin - zeitgerecht - andere, so sind auch diese daraufhin zu untersuchen, ob sie sich im Lichte der Kenntnisse des Täters als pflichtgemäß oder erneut pflichtwidrig darstellen. Sind sie pflichtgemäß, entfällt eine Strafbarkeit. Sind sie pflichtwidrig, ist zu prüfen, welche Maßnahmen stattdessen für den Täter erkennbar in Betracht gekommen wären. Hätten diese teils den Tod und die Verletzungen der Flutopfer nicht verhindert, stellt sich die Frage, ob die zum Tatzeitpunkt bestehende Erkenntnislage des Täters ihn verpflichtet hätte, die Maßnahme oder Maßnahmen zu treffen, die den Taterfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert hätten. Erst wenn man mit diesen Überlegungen dazu kommt, dass der Täter eine Handlung hätte vornehmen müssen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich geeignet gewesen wäre, die schrecklichen, Leib und Leben betreffenden Flutfolgen zu verhindern, ist zu prüfen, ob diese Handlungen tatsächlich auch im Einzelfall zu der Verhinderung des Taterfolges geführt hätten. Erst in diesem Moment kommt es also auf eine potentielle Reaktion der später Verstorbenen oder Verletzten auf die getroffenen Maßnahmen an.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese rechtliche Darstellung im Interesse einer besseren Verständlichkeit dieser Presseerklärung stark verkürzt ist. Eine ausführliche Darstellung aller durch die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz für die Beurteilung des Sachverhalts herangezogenen rechtlichen Gesichtspunkte ist im Bereich „Service und Informationen“ der Seiten der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz zum Download abrufbar.
III. Vor der Katastrophe
Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Beschuldigten und die weiteren für die Bewältigung der Katastrophenlage zuständigen Personen und Institutionen (Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienst, Lagezentren) sich dem jeweiligen Prognosegrad der Wetterdienste für die seinerzeit erwartbaren Niederschläge entsprechend auf das spätere Flutgeschehen vorbereitet haben. Zu fragen war in diesem Zusammenhang, ob die Beschuldigten - oder weitere am Katastrophenschutz beteiligte Stellen und Personen - die Vorkehrungen getroffen haben, die nach den ihnen bekannten Umständen angezeigt waren. Dies war - entsprechend der Beurteilung durch die Staatsanwaltschaft Koblenz - auch nach der Bewertung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz der Fall:
Zu den Wetterprognosen vor der Katastrophe haben mehrere Sachverständige vor dem Untersuchungsausschuss „Ahrflut“ des Landtages Rheinland-Pfalz ausgesagt. Sie stimmten überein, dass im Vorfeld der Flut zwar erhebliche Regenmengen prognostiziert worden waren, allerdings bis kurz vor dem Beginn der Katastrophe zum einen nicht bekannt war, wo diese genau niedergehen würden. Auch war aus meteorologischer Sicht nicht absehbar, welche Folgen die niedergehenden Regenmengen in Bezug auf sich daraus entwickelnde Hochwässer oder Flutwellen haben würden. Letzteres ergibt sich schon daraus, dass sich das Expertenwissen von Meteorologen auf die Wetter- und Klimavorgänge bezieht, sich jedoch nicht auf Auswirkungen von Wetterereignissen auf der Erde erstreckt. Dieses fällt in das Fachwissen von Hydrologen.
Die vor dem Untersuchungsausschuss gehörten Hydrologen und auch der von der Staatsanwaltschaft Koblenz beauftragte hydrologische Sachverständige haben übereinstimmend ausgeführt, dass selbst dann, wenn Ort und Menge von Niederschlägen bekannt seien, hieraus allein keine hydrologischen Ableitungen gezogen werden könnten, wie genau sich wegen der Regenmengen entstehende Hochwässer oder Flutwellen entwickeln würden. Dieses hänge von einer Vielzahl von Parametern - z.B. der Bebauung des beregneten Gebiets, der Wasserläufe und potenzieller Fließhindernisse, der Speicherfähigkeit der Böden während des Regens und deren vorherige Wassersättigung ab -, die sich im Voraus nicht modellieren ließen. So hängt z.B. der Eintritt einer Verklausung (insbesondere die Verstopfung eines Brückendurchlasses) nicht zuletzt von den in dem Fluss mitgeführten Gegenständen - Bäume, Camping- und sonstige Fahrzeuge, Tanks, Baumaterialien, Teile zerstörter Häuser - ab, deren Vorhandensein und Auswirkungen im Vorfeld eines Katastrophenereignisses nicht sicher prognostiziert werden können.
Als unzutreffend haben sich in diesem Zusammenhang Annahmen herausgestellt, das europäische Warnsystem System EFAS (European Flood Awareness System) habe das später eingetretene Flutgeschehen vorhergesagt. Das System eignet sich nicht für Hochwasservorhersagen kleiner Flussläufe wie die Ahr oder sonst kleinflächiger Gebiete. Hinzu kommt, dass - wie schon erläutert - aus Niederschlagsmengen keine hydrologischen Geschehensabläufe auf der Erde abgeleitet werden können.
Vor diesem Hintergrund sind die durch die Beschuldigten verantworteten oder vorgenommenen Vorkehrungen nicht zu beanstanden. Sie bestanden im Wesentlichen darin, alle an möglichen Katastrophenschutzerfordernissen beteiligten Stellen und Personen über die Wetterprognosen und ein darauf möglicherweise folgendes Hochwasser zu unterrichten, Vorkehrungen für ein unspezifisches Hochwasser zu treffen und die Situation ansonsten zu beobachten.
Ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten der Beschuldigten wie auch der anderen an den späteren Katastrophenschutzmaßnahmen beteiligten Stellen und Personen hat sich mithin bezogen auf die erste oben geschilderte Fragestellung nicht ergeben.
IV. Während der Katastrophe
Als aufwändiger und schwieriger erwies sich die Feststellung und rechtliche Bewertung des Handelns der für den Katastrophenschutz Verantwortlichen während der Katastrophe selbst. Hier bedurfte es zunächst einer Rekonstruktion des Ablaufs der Katastrophe und einer Rekonstruktion dessen, was den Beschuldigten - aber auch anderen für den Katastrophenschutz verantwortlichen Stellen und Personen - von diesem Ablauf bekannt war oder hätte bekannt sein müssen. Diese Rekonstruktion war schon deshalb nicht einfach, weil die Dokumentation des jeweiligen Wissensstandes und der hieraus abgeleiteten Maßnahmen mit Fortschreiten der Katastrophe immer stärker hinter der Durchführung der vielfältigen Rettungsmaßnahmen zurückgestellt worden war. Dies ist aus strafrechtlicher Sicht angesichts der massiven Gefährdungen von Leib, Leben und auch Eigentumswerten der Flutbetroffenen nicht zu beanstanden.
Anhand der erfolgten Rekonstruktionen war dann zu prüfen, ob die tatsächlich vorgenommenen Handlungen unter Berücksichtigung des Wissensstandes der Handelnden pflichtgemäß waren. Wo das nicht der Fall war, war zu klären, welche rechtmäßige Handlungen geboten und auch möglich gewesen wären. Diese hätten dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich den Tod oder die Verletzung von zu Schaden gekommenen Flutopfern verhindern müssen.
Was haben diese Prüfungen ergeben?
1. Entwicklung des Flutgeschehens
Zum Ablauf des Flutgeschehens ist zunächst festzuhalten, dass dessen Auslöser das äußerst ergiebige Regentief „Bernd“ war, das in erster Linie den nördlichen Einzugsbereich der Ahr beregnet hat. Dies ist von Bedeutung, weil der Umstand, dass vorrangig nicht das Ahrtal als solches, sondern der nördliche Bereich des Einzugsgebiets des Flusses beregnet worden ist, wesentlichen Einfluss auf das Flutgeschehen hatte. Überschwemmungen traten zunächst vorrangig an den Bächen nördlich des Ahrtals auf. So wurde beispielsweise in Antweiler zunächst ein Schulgebäude durch einen durch den Ort führenden Bach überschwemmt, das abseits der Ahr lag, während die Ahr selbst noch in ihrem Bett floss. Auch für den Bereich Altenahr schilderten Zeugen, dass das Wasser von „überall“ hergekommen sei, insbesondere auch von den das Ahrtal umgebenden Bergen.
Die Hangabflüsse und die Bäche, für die es - anders als im südlichen Einzugsgebiet der Ahr - nur wenige Pegel gab, entwässerten in die Ahr. Folge waren mehrere kleinere und größere Flutwellen entlang des Ahrtals. Diese wurden verstärkt durch Verklausungen, die sich ergaben, weil der Fluss infolge seiner durch die Wassermengen verursachten schnellen Fließgeschwindigkeit Gegenstände - Autos, Campingfahrzeuge, Tanks, Baume u.s.w. - in beträchtlichen Mengen mit sich riss. Verklausungen treten insbesondere auf, wenn Wasserdurchlässe der Brücken nicht mehr ausreichen, um den Wasserabfluss zu gewährleisten, weil sie z.B. durch mitgeführtes Treibgut verstopft werden. Störungen des Wasserabflusses durch Verklausungen sind - so einhellige Expertenmeinung - im Voraus nicht prognostizierbar. Sie hängen von einer Vielzahl sich dynamisch ändernder Faktoren ab. So ändert sich z.B. die Zahl und Art von entlang einem Fluss abgestellten oder bewegten Fahrzeuge ständig. Daher ist im Voraus nicht modellierbar, wie das Mitreißen von Autos sich auf ein Hochwasser- oder Flutgeschehen auswirken wird.
Nicht im Voraus modellierbar sind auch die Auswirkungen von Verklausungen. Diese führen jedenfalls zunächst zu einem Aufstauen des fließenden Wassers, was eine Erhöhung des Pegelstandes vor der Verklausung zur Folge hat. Dieses Phänomen war z.B. in Altenahr zu beobachten und erklärt, warum die ohnehin hohen Pegelprognosen für Altenahr erheblich übertroffen worden sind. Steigt vor einer Verklausung der Wasserdruck weiter, gibt ggf. die Brücke nach, so dass das aufgestaute Wasser sich schwallartig in das hinter der Verklausung liegende Flusstal ergießt. Wann und wie genau dies geschieht, ist abhängig vom Zustand der Brücke und dem Druck, den das Wasser mitsamt dem mitgeführten Treibgut auf sie ausübt. Auch dies ist mithin nicht im Voraus modellierbar. Hinzu kommt, dass der Bruch der Brücke auch nur eine denkbare Verklausungswirkung ist. Alternativ kann sich das steigende Wasser seinen Weg auch durch ein Umfließen des Hindernisses bahnen. Dies hat sich z.B. in Schuld als verhängnisvoll erwiesen, weil der für das Wasser einfachste Weg dort die durch den Ort führende Straße war, über die sich die Flutwelle schnell fortbewegen konnte. Bereits diese Überlegungen zeigen exemplarisch, dass die späteren Flutfolgen im Einzelnen sogar noch relativ kurz vor ihrem Entstehen nicht sicher prognostizierbar waren. Nicht nur der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Hydrologe hat hieraus nachvollziehbar geschlossen, dass es sich bei der Ahrflut um eine schwallartige Sturzflut gehandelt habe, ein Fluttyp, der an deutschen Binnengewässern äußerst selten vorkomme.
2. Vorstellungen der Beschuldigten über das Flutgeschehen
Angesichts dieses im Vorfeld nicht vorhergesehenen Geschehensablaufs war zu prüfen, welche Erkenntnisse die Beschuldigten wann von dem sich entwickelnden Flutgeschehen hatten. Die dazu geführten Ermittlungen haben ergeben, dass ihnen ein Bild von dem tatsächlichen Geschehen weitgehend gefehlt hat. So erhielt die Technische Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler Informationen oftmals spät und auch nicht vollständig. Grund hierfür war zum einen, dass die Personen, die möglicherweise Informationen hätten liefern können, ihrerseits mit zahlreichen Rettungs- und Hilfeeinsätzen beschäftigt waren, weiterhin aber auch, dass die Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Fortschreiten der Katastrophe abnahmen. So waren Mobilfunknetze teils erheblich beeinträchtigt und der auf eine Vielzahl von Sendemasten angewiesene Digitalfunk, der ohnehin vorrangig das Funken innerhalb einer Funkzelle - also nicht entlang des Flusstales - ermöglichte, wegen der Beschädigung von Masten oder dem Ausfall der Elektrizitätsversorgung teils ausgefallen und im Übrigen überlastet. Gleiches galt auch für das noch vorhandene analoge Funknetz. Hinzu kam, dass auch der Versuch missglückte, über einen Aufklärer Informationen zu sammeln, weil die Straßenverbindungen so gestört waren, dass beispielsweise Feuerwehrleute bis zu 300 km Umwege fahren mussten, um an ihren Zielort zu gelangen.
Bekannt waren durch die Benachrichtigungen des Landesamtes für Umwelt die sehr hohen Pegelprognosen und auch Überschwemmungen z.B. am Oberlauf der Ahr, später auch die Zerstörung von Häusern in Schuld sowie - ab 17.00 Uhr - weiterhin Rettungsversuche auf einem Campingplatz in Dorsel.
Alle diese Faktoren wiesen jedoch nicht konkret auf eine Sturzflut hin, sondern unterschieden sich nicht wesentlich von den bei dem „Jahrhunderthochwasser“ 2016 eingetretenen Hochwasserfolgen. Auch seinerzeit hatten Menschen durch Windeneinsätze von Campingwagendächern gerettet werden müssen. Dass die Beschuldigten keine Vorstellung von einer möglicherweise zu besonderen Maßnahmen Anlass gebenden Sturzflut gewonnen haben, sondern lediglich von einem ungewöhnlich starken Hochwasser ausgegangen sind, ist daher mit Blick auf ihre letztlich nicht ausreichende Informationssituation nachvollziehbar.
3. Informationsbeschaffung
Allerdings drängt sich die Frage auf, ob die Beschuldigten und andere am Katastropheneinsatz beteiligte Stellen und Personen verpflichtet gewesen wären, für die Erstellung eines umfassenderen Lagebilds zu sorgen, so dass in dem Unterlassen, dies zu tun, ein eigener Fahrlässigkeitsvorwurf liegen könnte. Auch hierzu haben die Ermittlungen jedoch keinen hinreichenden Tatverdacht erbracht.
Insoweit ist zunächst festzuhalten, dass eine Pflicht, der Technischen Einsatzleitung Informationen zu liefern, grundsätzlich zunächst bei den im Einsatz befindlichen Katastrophenschutzkräften zu suchen wäre, deren rechtliche Pflichtenstellung für den Katastropheneinsatz auch durch die Einsatzübernahme durch die Technische Einsatzleitung nicht erloschen war. Insoweit haben die Ermittlungen jedoch ergeben, dass auch die örtlichen Abschnitte und Einsatzkräfte über kein vollständiges Lagebild verfügt haben oder sie ihre Erkenntnisse aufgrund ihrer eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten offenbar nicht oder nur verspätet weitergeben konnten. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass die örtlichen Feuerwehreinsatzzentralen aufgrund der zunehmenden Überlastungen und Ausfälle der Technischen Infrastruktur am 14.07.2021 schon ab etwa 16:00 Uhr in der Verbandsgemeinde Adenau und ab zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Verbandsgemeinde Altenahr weitgehend außer Stande waren, mit der Technischen Einsatzleitung in Verbindung zu treten.
Selbst wenn man in diesem Zusammenhang Versäumnisse sehen wollte, wären diese jedoch strafrechtlich ohne Bedeutung, denn die eingesetzten Kräfte hatten vor Ort fortlaufend Rettungs- und Hilfeeinsätze zu leisten, durch die auch Menschen gerettet worden sind. Diese Pflicht steht strafrechtlich gleichberechtigt neben einer etwa bestehenden Pflicht zur Informationsweitergabe an die Technische Einsatzleitung.
Weiterhin stellte sich die Frage, ob die Beschuldigten ihrerseits auf bessere Informationen hätten drängen müssen. Auch insoweit ist jedoch ein strafrechtlich relevantes Unterlassen nicht erkennbar. So hat namentlich der Leiter des Einsatzes zeitweise versucht, an Informationen zu kommen, ist damit allerdings an den weitgehend fehlenden Kommunikations- und Aufklärungsmöglichkeiten faktisch gescheitert.
Im Ergebnis war daher aus strafrechtlicher Sicht eine mögliche strafrechtliche Relevanz der Handlungen der Beschuldigten an ihrem durch die Ermittlungen festgestellten Wissensstand in der Flutnacht zu messen. Danach hatten die in der Technischen Einsatzleitung tätigen Personen aus den ihnen zur Verfügung stehenden Informationen lediglich den Eindruck gewonnen, das Flutgeschehen entspreche in seinem Ablauf weitgehend dem sogenannten „Jahrhunderthochwasser“ fünf Jahre zuvor, auch wenn die Wasserstände 2021 deutlich höher waren und die Folgen größer sein würden. Ein solches Hochwasser haben sie in seinen Auswirkungen für im Wesentlichen beherrschbar gehalten. Dass es sich um eine „schwallartige Sturzflut“ gehandelt hat, haben die in der Technischen Einsatzleitung tätigen Personen eigenen Aussagen zufolge erst am Folgetag erkannt, als sie nach einer kurzen Schlafpause bei Tageslicht zur Technischen Einsatzleitung zurückkehrten, um dort weiter Dienst zu tun, und auf der Fahrt den Grad der Zerstörung erkannten, den die Flut angerichtet hatte.
Der Unterschied zwischen einem - wenn auch hohen - Hochwasser und einer Sturzflut, wie sie tatsächlich stattgefunden hat, war für die Beurteilung der Auswirkungen erheblich: Ein Hochwasser ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich mit dem steigenden Wasserstand eher langsam und gleichmäßig seitwärts in die Flächen links und rechts des Flussbettes ausbreitet. Wenn es sich von dort zurückzieht, bleibt Wasser in natürlichen Mulden und Senken, aber auch in den Kellern von Häusern stehen. Auch hierdurch können Sachwerte beschädigt werden und Menschen zu Schaden kommen, die Wassermengen ausgesetzt werden, in denen sie ertrinken können. Das Gefährdungspotenzial eines solchen Hochwassers hätte gleichwohl unter dem gelegen, was sich durch die schwallartige Sturzflut tatsächlich verwirklicht hat.
Diese war durch Flutwellen gekennzeichnet, die sich mit hoher Geschwindigkeit entlang des Flusstales fortgesetzt und dabei mit großer Kraft riesige Zerstörungen angerichtet haben. Hierdurch veränderte sich die flutbedingte Bedrohung für die betroffenen Menschen oftmals nur innerhalb weniger Minuten dramatisch. Infolge der atypischen Fließrichtungen, die aus Auf- und Rückstauungen an zahlreichen Brücken und Engpässen und späteren Durchbrüchen resultierten, drang das Wasser dabei mitunter aus mehreren Richtungen zugleich in die jeweiligen Orte vor. Hierdurch wurden etwa in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch in einer Entfernung von annähernd 500 m zur Ahr Straßenzüge massiv überflutet, die selbst im Falle eines Extremhochwassers in den damaligen Hochwassergefahrenkarten nicht als überflutungsgefährdet ausgewiesen waren, während andere Bereiche, die sich deutlich näher an der Ahr befanden, nur geringfügig betroffen waren.
4. Getroffene Maßnahmen
Neben ihrer Aufgabe, Rettungseinsätze zu koordinieren und zur Verfügung stehendes Personal an Stellen zu verlegen, an denen es benötigt wurde, hatten die Feuerwehren und die Technische Einsatzleitung - soweit es um Räumungen oder Evakuierungen gemeinsam mit dem beschuldigten früheren Landrat geht - über Warnungen an die Bevölkerung zu entscheiden.
Insbesondere diese haben zeitnah nach der Flutkatastrophe Kritik in der Öffentlichkeit erfahren, weil sie als nicht ausreichend angesehen worden sind. Daher wurden die erfolgten Warnungen und Räumungen zunächst ermittelt und dann daraufhin bewertet, ob sie in pflichtverletzender Weise ergangen sind.
a) „Katastrophenalarm“
Kritik hatte sich u.a. daran entzündet, dass der Landkreis Ahrweiler zunächst keinen „Katastrophenalarm“ ausgelöst hatte. Hierzu ist zunächst anzumerken, dass es formal betrachtet zur Tatzeit in Rheinland-Pfalz einen „Katastrophenalarm“ nicht gab. Das Katastrophenschutzrecht unterschied vielmehr fünf Katastrophenstufen. Während bei Katastrophen der ersten drei Stufen die Kommunen vor Ort für die Katastrophenabwehr zuständig waren, hatte ab der vierten Stufe - die dadurch gekennzeichnet war, dass mehrere Kommunen betroffen waren - der Landkreis diese Aufgabe zu übernehmen. Die fünfte und höchste Stufe unterschied sich von der vierten Stufe insoweit, als bestimmte Maßnahmen - insbesondere die Anforderung der Bundeswehr - nur in ihr zulässig war. Ungeachtet der Frage, ob es danach sachgerecht gewesen wäre, einen Katastrophenfall der Stufe 5 früher als geschehen anzunehmen, wäre dies jedoch jedenfalls hinsichtlich der eingesetzten Mittel ohne Auswirklungen geblieben, denn schon zu der Zeit, als lediglich Stufe 4 angenommen wurde, waren vielfältige Bemühungen unternommen worden, Hilfe durch die Bundeswehr und auch amerikanische Streitkräfte zu organisieren. Die mögliche Verspätung der Feststellung der Stufe 5 hat mithin keine erkennbaren Auswirkungen auf die tatsächlich getroffenen Maßnahmen gehabt.
b) Warnungen und Räumungen
Kritisiert wird weiterhin, dass Warnungen und Räumungen nicht oder nicht in ausreichender Weise erfolgt seien. Zusammengefasst konnte insoweit Folgendes festgestellt werden:
Zunächst ist festzuhalten, dass über eine längere Zeit der Katastrophe hinweg der Regen vor allem Überflutungen mehrerer Bäche im Einzugsgebiet der Ahr verursachte, die zusammen mit Hangabflüssen des Regenwassers auch in Ortschaften im Ahrtal selbst zu Überschwemmungen führten. Etwa ab 20:30 Uhr oder 21:00 Uhr haben dann Zeugen Flutwellen der Ahr selbst beschrieben.
Die örtlichen Feuerwehren hatten sich für den Katastrophentag auf Hochwässer vorbereitet und befanden sich in Alarmbereitschaft. Neben den bei Hochwasserereignissen üblichen Tätigkeiten (Anbringung von Hochwasserschutz, Pump- und Absicherungsarbeiten, Sperrung von Straßen u.s.w.) erfolgten Warnungen von als besonders gefährdet angesehenen Bevölkerungsteilen beispielsweise auf dem Campingplatz Stahlhütte zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr. Kurze Zeit später versuchten die Feuerwehr und der Pächter eine Räumung des Platzes zu erreichen. Auch die Nutzer weiterer Campingplätze in der Verbandsgemeinde Altenahr wurden frühzeitig vor Hochwassergefahren gewarnt. Die dortige Jugendherberge wurde gegen Mittag geräumt. Weitere Warnungen der Bevölkerungen erfolgten vereinzelt schon ab dem Mittag des 14.07.2021, im weiteren Verlauf dann - soweit feststellbar - in den übrigen Orten entlang der Ahr durch die örtlichen Feuerwehren mittels Lautsprecherdurchsagen. Entsprechend wurde z.B. in Brück bereits ab 15.00 Uhr, in den übrigen Orten der Verbandsgemeinde Altenahr ab 16.00 Uhr gewarnt. Dabei erstreckten sich die Warnungen in den ersten Stunden der Katastrophe vorrangig auf die Gefahr von Hochwasser und das Räumen von Kellerräumen. Außerdem wurde das Wegfahren von Fahrzeugen in höher gelegene Gebiete angeraten.
In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden die Ahranwohner schon am Vormittag des 14.07.2021 durch Mitarbeitende des Ordnungsamtes aufgefordert, nicht an der Ahr zu parken, keine Autos in die Tiefgaragen zu stellen, die Gebäude zu sichern, Sandsäcke am Bauhof der Stadt abzuholen, Keller zu räumen und Wertsachen und persönliche Gegenstände bereitzuhalten. Weiterhin erfolgten Kontrollfahrten der Feuerwehr entlang der Ahr. Um 16:50 Uhr veröffentlichte das Ordnungsamt der Stadt eine Presseerklärung, die auch in das Internet (Homepage, Facebook-Seite) eingestellt wurde. Sie verwies auf ein drohendes Hochwasser und enthielt den Hinweis, dass die Ahr infolge der anhaltenden Regenfälle und der aktuell prognostizierten Pegelstände, die sich zudem jederzeit ändern könnten, womöglich in den frühen Morgenstunden in der benachbarten Verbandsgemeinde Altenahr ihren Höchststand erreichen werde. Nach 15:30 Uhr bis etwa 18:30 Uhr erfolgten Lautsprecherdurchsagen in der Stadt, in denen auf innerhalb der nächsten 24 Stunden drohende Überschwemmungen hingewiesen und aufgefordert wurde, Tiefgaragen und Keller zu meiden und Autos wegzufahren. Außerdem wurde auf mögliche Stromausfälle hingewiesen.
Ab 19:15 Uhr bis etwa 21:00 Uhr nahm die Feuerwehr zusätzliche Erkundungsfahrten und weitere Lautsprecherdurchsagen vor. Darin wurde auf die sehr große Hochwassergefahr und mögliche Überflutungen innerhalb der nächsten 24 Stunden mit Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen hingewiesen. Erneut wurde die Bevölkerung aufgefordert, Keller und Tiefgaragen zu meiden, flussnahe Gebäude gegen Überschwemmungen zu sichern, sich nicht in tieferliegendem Gelände aufzuhalten, Autos nicht in Tiefgaragen oder in der Nähe der Ahr abzustellen und dort parkende Fahrzeuge wegzufahren. Weiterhin wurde empfohlen, unbedingt auf die eigene Sicherheit und die Anweisungen der örtlichen Einsatzkräfte zu achten, sich über die Medien fortlaufend zu informieren und das Wetter- und Abflussgeschehen im Blick zu behalten. Um 19:44 Uhr wurden überdies die entsprechenden Inhalte auf die Facebook-Seite der Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie die Facebook-Seite und die Homepage der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in das Internet gestellt.
Um 19:15 Uhr wurde ferner die städtische Meldung des Ordnungsamtes von 16:50 Uhr nochmals auf der Homepage und der Facebook-Seite der Stadt im Internet veröffentlicht und die Bevölkerung unter Hinweis auf die KATWARN-Meldung des Landesamts für Umwelt von 17:17 Uhr - die auf eine Erhöhung der Hochwasserwarn-stufe auf Stufe 5 durch den Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz verwies - gebeten, ihre Fahrzeuge aus den Tiefgaragen zu fahren und an einem sicheren Ort abzustellen. Um 19:45 Uhr erfolgte sodann ein weiteres Update der städtischen Meldung von 16:50 Uhr, in der darauf verwiesen wurde, dass der Strom in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes gegebenenfalls abgestellt werden müsse, sofern die Ahr über die Ufer trete. Um 21:05 Uhr nahm die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler eine KATWARN-Meldung vor, in der auf mögliche Stromabschaltungen und örtliche Überschwemmungsgefahren sowie einen zu erwartenden Pegelstand der Ahr von über 5 m verweisen wurde. Die Meldung enthielt weiterhin die Empfehlung, sich nicht in Kellern, Tiefgaragen und Erdgeschosswohnungen aufzuhalten, nicht durch überflutete Straßen zu fahren, sich nicht in der Nähe von Bach- und Flussläufen aufzuhalten, Abflüsse und Schächte freizuhalten, überflutungsgefährdete Bereiche und deren Zugänge und Fenster zu sichern und sich über Radio, Internet und Fernsehen über die Hochwasserlage zu informieren. Weiterhin wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, sich auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz über bestimmte Verhaltensweisen zu informieren. Nach 21:30 Uhr bis etwa 22:00 Uhr erfolgten weitere Lautsprecherdurchsagen und auch persönliche Kontaktaufnahmen im Stadtgebiet, die darauf zielten Autos wegzufahren. Ab spätestens 22:00 Uhr gab es weitere Durchsagen, in denen u.a. dazu aufgefordert wurde, sich in höhere Stockwerke zu begeben. Ab 22:15 Uhr wurde dazu aufgefordert, die Brücken im Stadtgebiet zu verlassen.
Die Feuerwehr der Stadt Sinzig warnte schon am 13.07.2021 auf ihrer Internetseite unter Hinweis auf die amtlichen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor heftigem Starkregen mit einem Niederschlag von bis zu 180 l/m² und möglichen Überflutungen für das Stadtgebiet Sinzig in der Zeit vom 13.07.2021 bis 15.07.2021 und empfahl, entsprechende Vorkehrungen zu treffen sowie auf die aktuellen Entwicklungen zu achten und sich auf den amtlichen Informationsportalen, unter anderem des Deutschen Wetterdienstes, über potentielle Gefahrenlagen zu informieren. Die Meldung enthielt den Hinweis, dass der Pegel der Ahr auch dann stark ansteigen könne, wenn es im Stadtgebiet Sinzig keine enormen Regenfälle geben solle. Am Abend des 13.07.2021 erging eine inhaltsgleiche Pressemeldung der Stadt Sinzig.
Am 14.07.2021 nahm die örtliche Feuerwehr ab 16:20 Uhr Lautsprecherdurchsagen vor, in denen auf eine drohende - über diejenige von 2016 hinausgehende - Hochwasserlage und die Möglichkeit eines schnellen Anstiegs der Ahr hingewiesen wurden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fahrzeuge wegzufahren, Keller bei Überflutungsgefahr zu meiden, und Vorkehrungen für Keller, Garagen und Gefahrenbereiche sowie Sicherungsvorkehrungen mit Sandsäcken zu treffen. Die Feuerwehr sprach insoweit in ufernahen Bereichen auch persönlich bei Anwohnern vor. Inhaltsgleiche Hinweise waren bereits um 15:06 Uhr über die Webseite der Feuerwehr und um 16:49 Uhr über soziale Medien abgesetzt worden. Diese Warnungen wurden spätestens ab 20.30 Uhr wiederholt. Um 21:34 Uhr erging ein Auftrag an die Einsatzkräfte, persönlich durch Klingeln an den Wohngebäuden verstärkt zu warnen und den Anwohnern zu empfehlen, Gegenstände möglichst in Sicherheit respektive in höher gelegene Stockwerke zu bringen, tiefergelegene Gebäudeteile nicht zu nutzen, Warnhinweise zu verfolgen und sich gegebenenfalls auf eine Evakuierung einzustellen. Dies wurde umgesetzt.
Nach dem Eingang von Hinweisen der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Ahrweiler um 21:45 Uhr, wonach am Oberlauf der Ahr und der mittleren Ahr mehrere Häuser eingestürzt seien und deshalb Treibgut nach Sinzig gelangen könne, erfolgten ab 22:00 Uhr bis 00:30 Uhr nochmals persönliche Hinweise auf die erhöhte Gefährdungslage und Empfehlungen, Gegenstände in Sicherheit zu bringen, tiefergelegene Gebäudeteile wie Keller und Souterrainwohnungen nicht zu nutzen, Warnhinweise zu befolgen und sich unter Umständen auf eine auch schnelle Räumung von Häusern einzustellen.
Ab etwa 22:39 Uhr fanden nach vorheriger Einbeziehung der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Ahrweiler, die gebeten wurde, einen mittelfristigen Betreuungsdienst für knapp 1000 Personen zu organisieren, Planungen und Vorbereitungen für Evakuierungen statt. Hierzu wurde die örtlich zuständige Polizei Remagen gebeten, eine Übersicht der in Sinzig entlang der Ahr gemeldeten Personen zu erstellen. Sodann wurde die Räumung verschiedener Straßenzüge, darunter auch die Straßen In den Ahrwiesen und Pestalozzistraße, an denen sich die Einrichtungen der Lebenshilfe befanden, geplant. Die eingeleiteten Räumungen beschränkten sich dabei nicht auf einen 50 m-Korridor rechts und links der Ahr, sondern richteten sich zusätzlich an den potentiellen Extremwerten der örtlichen Hochwassergefahrenkarten aus. Die Planungen schlossen die Evakuierung von insgesamt etwa 2.000 Personen sowie die Errichtung von entsprechenden Betreuungsstellen ein. Hierzu wurden weitere Unterstützungskräfte angefordert. Als Anlaufstelle für die zu evakuierenden Personen wurde zunächst der Helenensaal in der Koblenzer Straße bestimmt, später zusätzlich die Rheinhalle in Remagen. Die Technische Einsatzleitung des Landkreises Ahrweiler wurde entsprechend unterrichtet. Von am 15.07.2021 um etwa 00.00 Uhr begonnenen und bis 02:11 Uhr fortgeführten Evakuierungen von rund 500 Personen waren zunächst die Bereiche Sportplatz, Grüner Weg, Am Teich und Kripper Straße betroffen, weil dort Wasser infolge einer punktuellen Verschärfung der Lage über die Straßen zu laufen begann. Nach 00:00 Uhr, ggf. auch erst um 01:00 Uhr erging der Auftrag, auch die Bevölkerung in den übrigen Bereichen zu evakuieren. Die Räumungen gestalteten sich nicht immer problemlos, weil Menschen beispielsweise eine Katze oder Gegenstände mitnehmen wollten oder sie auch auf die Signale der Feuerwehr, mit der diese sich bemerkbar zu machen versuchte, nicht reagierten.
In dem Stadtteil Bad Bodendorf wurde zunächst versucht, die Menschen zu evakuieren, deren Häuser sich innerhalb einer Entfernung von 50 m zum Ufer der Ahr befanden. Hier wurden deshalb am 14.07.2021 um 23:20 Uhr zunächst entsprechende Polizeikräfte und Mitarbeiter des DRK angefordert und dann um 23:30 Uhr Vorkehrungen für ein Auffanglager getroffen und Transportmöglichkeiten organisiert. Weiter wurde gegen 23:45 Uhr die Evakuierung der Josef-Hardt-Allee ahrseitig und eines Wohnkomplexes in der Bäderstraße vorbereitet. Zuvor waren gegen 22:45 Uhr in der Josef-Hardt-Allee und dem Wohnkomplex weitere Durchsagen erfolgt, mittels derer die Bewohner aufgefordert wurden, die oberen Stockwerke aufzusuchen respektive die Häuser zu verlassen. Am 15.07.2021 erfolgten ab 00:05 Uhr Lautsprecherdurchsagen in der Josef-Hardt-Allee, wonach diese ahrseitig evakuiert werden müsse, und mit denen die Anwohner gebeten wurden, sich zu einer höhergelegenen Straße zu begeben. Gegen 00:07 Uhr respektive 00:18 Uhr respektive 00:30 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit der Evakuierung von Gebäuden in der Bäderstraße, der rechten Seite der Josef-Hardt-Allee einschließlich eines dort befindlichen Seniorenpflegeheims und von Teilen der Rosenstraße.
Spätestens gegen 02:25 Uhr oder 02:30 Uhr setzten im Stadtteil Sinzig Evakuierungen in weiteren Straßen ein. Zuvor waren gegen 23:00 Uhr bereits entsprechende Vorwarnungen erfolgt.
Die zu diesem Zeitpunkt zwar schon besetzte, jedoch noch nicht einsatzleitende Technische Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler setzte am 14.07.2021 um 14:34 Uhr eine KATWARN-Meldung für den Landkreis Ahrweiler ab, in der auf drohende örtliche Überschwemmungsgefahren aufgrund der Vorhersage von Dauer- respektive Starkregen hingewiesen wurde. Die Warnung umfasste die Empfehlung, bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller und Tiefgaragen zu gehen, nicht durch überflutete Straßen zu fahren sowie Abflüsse und Schächte freizuhalten, sich über das Radio, Internet und Fernsehen über die weiteren Verläufe zu informieren, Bäche und Flussläufe bei Überschwemmungsgefahr zu meiden und überflutungsgefährdete Bereiche und deren Zugänge und Fenster zu sichern. Weiterhin wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, sich auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über geeignete Verhaltensweisen zu informieren. Um 15:26 Uhr, 18:26 Uhr und 21:26 Uhr wurden die jeweils aktuellen Pegelprognosen des Landesamtes für Umwelt an die einzelnen Abschnitte und Wehrleiter mittels E-Mail-Nachrichten weitergeleitet. Nach der um 17.40 Uhr erfolgten Übernahme der Einsatzleitung von den bis dahin zuständig gewesenen Verbandsgemeinden - die nunmehr zu Abschnittsverantwortlichen wurden - wurde der Eintritt der Alarmstufe 4 des Rahmen-Alarm- und Einsatzplanes Hochwasser bekannt gegeben. Die Kreisverwaltung Ahrweiler unterrichtete nach 18:00 Uhr die acht hauptamtlichen Bürgermeister des Landkreises über ein bevorstehendes Hochwasser, verbunden mit der Bitte, Sandsäcke zu befüllen und an die Bevölkerung auszugeben.
Um 19:35 Uhr veröffentlichte die Technische Einsatzleitung eine KATWARN-Meldung. Darin wurde über mögliche örtliche Überschwemmungen und einen zu erwartenden Pegelstand von über fünf Metern informiert. Gleichzeitig wurde empfohlen, sich nicht in Kellern, Tiefgaragen und Erdgeschosswohnungen aufzuhalten, nicht durch überflutete Straßen zu fahren, Bach- und Flussläufe zu meiden, Abflüsse und Schächte freizuhalten und überflutungsgefährdete Bereiche und deren Zugänge und Fenster zu sichern, und sich über das Radio, Internet und Fernsehen über die weiteren Entwicklungen zu informieren. Erneut wurde auch auf die Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verwiesen. Diese KATWARN-Meldung wurde auch an sämtliche Feuerwehreinsatzzentralen und die Abschnitte entlang der Ahr weitergegeben und um 21:05 Uhr inhaltlich gleichlautend auf der Facebook- und Internetseite des Landkreises Ahrweiler veröffentlicht. Die weitergehenden Warnungen wurden in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen 21:05 Uhr und nach 22:00 Uhr entsprechend umgesetzt.
Um 20:38 Uhr versandte der Landkreis eine Presseerklärung an einen Presseverteiler mittels E-Mail, in der vor Hochwasser und Starkregen gewarnt und auf die sehr große Hochwassergefahr und den Eintritt der Alarmstufe 4 einschließlich der Übernahme der überörtlichen Einsatzleitung sowie den erwarteten Pegelstand von 5,09 m - mit steigender Tendenz - am Pegel Altenahr, auf laufende Einsätze, die Zahl der Einsatzkräfte und die Anforderung von weiteren Kräften sowie auf Personenrettungen in den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr von Campingwagendächern hingewiesen wurde. Auch diese Erklärung wurde um 20:46 Uhr auf Facebook, um 20:56 Uhr auf Twitter und um 21:09 Uhr auf der Homepage des Landkreises Ahrweiler veröffentlicht.
Um 22:04 Uhr ordnete die Technischen Einsatzleitung - soweit ersichtlich in telefonischer Absprache mit dem beschuldigten früheren Landrat - eine begrenzte horizontale Evakuierung in einem Korridor von 50m rechts und links der Ahr in den Städten Bad-Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig sowie in dem Sinziger Stadtteil Bad Bodendorf an. Weiterhin wurden sämtlicher Brücken im Stadtgebiet Bad-Neuenahr-Ahrweiler mit Betretungsverbot gesperrt und die Einrichtung von Notunterkünften angekündigt. Die Meldung enthielt einen Hinweis auf zerstörte Häuser in den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr und verwies auf eine sehr ernste Lage und bestehende Lebensgefahr. Hingewiesen wurde ferner auf eine Überlastung der Notrufe verbunden mit der Bitte, diese nur noch in dringenden Fällen zu betätigen. Diese Anordnung wurde erst um 23:09 Uhr über die App KATWARN, um 23:22 Uhr über die Presse, um 23:23 Uhr über Twitter und um 23:27 Uhr über Facebook und auf der Internetseite des Landkreises Ahrweiler technisch umgesetzt und veröffentlicht, weil der für die Umsetzung erforderliche Mitarbeiter wegen eines anderen Einsatzes zeitweise nicht verfügbar war. Sie wurde weiterhin an alle örtlichen Feuerwehreinsatzzentralen weitergeleitet.
Die über KATWARN abgesetzten Warnungen sollten auch automatisch in der Warnapp NINA angezeigt werden. Dies erfolgte jedoch wegen eines technischen Schnittstellenproblems bei dem Betreiber der App KATWARN, der erst mehrere Wochen später auffiel und der der Technischen Einsatzleitung nicht bekannt war, in der Flutnacht nicht.
c) Bewertung
Zunächst ist festzuhalten, dass die zeitweise geäußerte Annahme, es sei überhaupt nicht gewarnt worden, in den geführten Ermittlungen keine Stütze gefunden hat. Sowohl die örtlichen Feuerwehren wie auch die Technische Einsatzleitung haben Warnungen ausgesprochen. Diese Feststellung führt zu der Frage, ob die festgestellten Warnungen und Anordnungen ausreichend - bzw. strafrechtlich betrachtet pflichtgemäß - waren. Die entstandenen Flutfolgen mit vielen Toten und Verletzten scheinen darauf hinzudeuten, dass dies jedenfalls im Ergebnis nicht der Fall war.
Eine solcher Schluss von den traurigen Folgen der Flut auf ein pflichtwidriges Verhalten wäre jedoch strafrechtlich zu kurz gesprungen. Er lässt nämlich außer Betracht, dass - wie oben schon zusammengefasst ausgeführt - die strafrechtliche Relevanz einer möglichen Pflichtwidrigkeit auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Warnungen bestehenden Wissensstandes der handelnden Personen zu beurteilen ist. Zieht man diesen heran, ist - wie ebenfalls schon ausgeführt - zu berücksichtigen, dass weder den Feuerwehren vor Ort noch der Technischen Einsatzleitung des Landkreises als Pflichtwidrigkeit zu Last zu legen ist, die schwallweise Sturzflut nicht erkannt zu haben. Die Warnungen und Anordnungen waren daher daraufhin zu überprüfen, ob sie für ein schweres Hochwasser ausreichend gewesen wären.
Zweifel ergeben sich daran insoweit, als die Warnung der Technischen Einsatzleitung von 19:35 Uhr vor einem Aufenthalt in Erdgeschosswohnungen möglicherweise nicht sofort flächendeckend von den Feuerwehren vor Ort umgesetzt worden ist, zum anderen aber auch deshalb, weil die um 22.04 Uhr ergangene Räumungsanordnung lediglich einen Streifen von 50 Metern links und rechts der Ahr vorsah. Insoweit konnte durch die Ermittlungen nicht herausgefunden werden, welche Überlegungen dieser Anweisung zur Räumung des - im Nachhinein betrachtet - zu schmalen Streifens zugrunde gelegen haben. Hinzu kam, dass diese Anordnung auch erst nach 23.00 Uhr in KATWARN und den Medien veröffentlich worden ist.
Wäre die möglicherweise nicht unverzüglich erfolgte Umsetzung der Warnungen in Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr als Pflichtwidrigkeit anzusehen, würde dies nicht in die Verantwortung der Beschuldigten fallen, sondern in die der örtlichen Feuerwehren. Gegen diese hat sich jedoch kein entsprechender Anfangsverdacht ergeben, denn es muss berücksichtigt werden, dass die Warnung nicht mit ihrer Bekanntgabe schon umgesetzt war, sondern hierzu die bereits im Einsatz befindlichen Feuerwehrleute informiert und die Banddurchsagen geändert werden mussten. Dies ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler jedenfalls schrittweise geschehen, wie Zeugenaussagen über die Inhalte der von den Feuerwehrfahrzeugen ausgestrahlten Warnungen belegen.
Was die verspätete Veröffentlichung der um 22.04 Uhr getroffenen Anordnung der Räumung eines Streifens von 50 Metern links und rechts der Ahr über KATWARN betrifft, ging diese - wie bereits erwähnt - darauf zurück, dass der hierzu benötigte Mitarbeiter wegen eines anderen Einsatzes zeitweise nicht verfügbar war. Schon dies wirft Zweifel an einer Pflichtwidrigkeit der verspäteten Einstellung in KATWARN auf. Ungeachtet dessen kommt es darauf aber auch nicht an, da diese Anordnung zuvor bereits an die örtlichen Feuerwehreinsatzzentralen versandt worden war.
Zuletzt war die angeordnete Räumungsfläche auf Pflichtwidrigkeiten hin zu untersuchen. Insoweit ist auch die Generalstaatsanwaltschaft der Auffassung, dass der Streifen von 50 Metern auch unter Berücksichtigung des Wissensstandes der Technischen Einsatzleitung - diese ging von einem massiven Hochwasser aus - eher klein gewählt war. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb die Räumungsanordnung keinen Bezug auf die für den Landkreis Ahrweiler bestehenden Hochwasserkarten hergestellt hat. Auf der anderen Seite musste sich die Räumungsanordnung jedoch auch an den real bestehenden Möglichkeiten orientieren, sie auch praktisch umzusetzen. Dies erfordert - zumal am späten Abend - erheblichen zeitlichen Vorlauf, da eine Vielzahl von Menschen ggf. geweckt und dann von der Räumung überzeugt werden musste. Gut ersichtlich werden die Schwierigkeiten, die eine Räumung mit sich bringt, aus Aussagen der Feuerwehrleute in der Stadt Sinzig. Hinzu kommt, dass auch jeweils die Frage geklärt werden musste, wohin die geräumten Personen sich hätten begeben sollen. Führt man sich dann noch vor Augen, dass zwischen der Warnung und dem Eintreffen der Flutwellen in Bad Neuenahr-Ahrweiler nur etwas mehr als eine Stunde lagen, ergeben sich keine hinreichenden Hinweise darauf, dass ein anders gewählter Räumungsraum dort Todesfälle verhindert hätte. In der Stadt Sinzig mit ihren Stadtteilen stellt sich die Frage, ob der Streifen zu schmal gewählt war, ohnehin nicht, da dort die Feuerwehr infolge eigener Entscheidungen davon abweichende Evakuierungsbereiche gebildet hatte.
Zusammenfassend sieht nach alledem die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz keine strafrechtlichen Pflichtverletzungen durch die Handelnden in der Technischen Einsatzleitung oder die vor Ort tätigen Feuerwehrkräfte.
d) Rolle des früheren Landrats
Kritisch beleuchtet wurde in der Öffentlichkeit die Rolle des beschuldigten früheren Landrats in der Flutnacht. Dabei wurde insbesondere thematisiert, dass dieser sich nicht im Gebäude der Kreisverwaltung aufgehalten habe. Anzumerken ist insoweit zunächst, dass der damalige Landrat zumindest telefonisch erreichbar war und mit ihm einzelne Maßnahmen wohl abgesprochen worden sind. Ungeachtet dessen haben die Ermittlungen jedoch auch keine Hinweise darauf ergeben, dass er über Erkenntnisse verfügt hätte, die über den vorstehend geschilderten Wissensstand hinausgingen Er hätte daher keine besseren Maßnahmen treffen können.
Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Umstand, dass bei dem Landkreis Ahrweiler in der Flutnacht kein vollständiger Führungsstab eingerichtet worden war und insbesondere der politisch-administrative Anteil dieses Stabes gefehlt hat. Darüber, dass ein vollständiger Führungsstab zu anderen Bewertungen gekommen wäre, lässt sich allenfalls spekulieren. Hinweise darauf finden sich im Ergebnis der Ermittlungen nicht.
IV. Organisationsverschulden
Auch etwa feststellbare, generelle Organisationsmängel des Katastrophenschutzes im Landkreis Ahrweiler vermögen im Ergebnis den Vorwurf strafrechtlich relevanten Verhaltens nicht zu begründen. Insoweit gilt, dass dem Landkreis, dem Landrat und den Gremien des Landkreises eine Vielzahl von rechtlich zulässigen und auch geeigneten Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung gestanden hätten, um den Katastrophenschutz generell besser zu gestalten. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass alle zulässigen und daher aus strafrechtlicher Sicht pflichtgemäßen Gestaltungen - die sich mangels Vorhersehbarkeit nicht auf die Frage einer schwallartigen Sturzflut bezogen hätten - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Tod von Menschen ganz oder teilweise in der Flutnacht verhindert hätten, haben sich schon zu Beginn und auch im Verlauf der Ermittlungen nicht ergeben.
V. Sinzig
Besonderes Augenmerk wurde während der Ermittlungen aus den bereits dargestellten Gründen auf den Tod von zwölf Menschen in Bezug auf die Einrichtung der Lebenshilfe gelegt. Die Ermittlungen haben hierzu Folgendes ergeben:
Die Einrichtung der Lebenshilfe gliederte sich in zwei Gebäudekomplexe. Während das zweigeschossige und zwei Wohngruppen beherbergende Haupthaus an der Pestalozzistraße gelegen war, befanden sich weitere Wohngruppen in der Straße „In den Ahrwiesen“ in einem dort gelegenen Doppelhaus. Der Betreuer im Nachtdienst, der für sämtliche Wohngruppen zuständig war, hielt sich im Haupthaus auf.
Die Feuerwehr in Sinzig hatte ihre Warnungen offensichtlich an den Hochwasserkarten für die Stadt Sinzig orientiert. Zu warnen waren danach auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser der Lebenshilfe „In den Ahrwiesen“ und Pestalozzistraße, die knapp 280 m von der Ahr entfernt waren und sich am äußersten Rand der in den damaligen Hochwassergefahrenkarten im Falle eines Extremszenarios als potentiell gefährdeten ausgewiesenen Flächen befanden. Dieses Gebiet war dort mit einer Überflutungstiefe zwischen 0,5 m und 1 m verzeichnet. Die Warnung erfolgte am 14.07.2021 gegen 23:00 Uhr oder 23:15 Uhr. Worauf sie sich genau bezogen hat, konnte durch die Ermittlungen nicht eindeutig festgestellt werden. Der Betreuer der Lebenshilfe hat angegeben, er sei von einem Hochwasser gewarnt worden. Dabei sei ihm gesagt worden, er solle schon einmal alles vorbereiten, u.a. um ohne Strom auszukommen. Wenn man Näheres wisse, werde die Feuerwehr nochmals vorbeikommen. Der Betreuer habe dann Kerzen vorbereitet und Matratzen im ersten Geschoss ausgelegt. Über diesen Besuch und diese Warnung hat er auch seiner nicht vor Ort befindlichen Vorgesetzen berichtet. Der vernommene Feuerwehrmann hat angegeben, er habe den Betreuer aufgefordert, die Bewohner des Erdgeschosses in das erste Obergeschoss zu verbringen. Eine abschließende Feststellung, welche dieser Darstellungen zutrifft, lässt sich durch die Ermittlungen nicht treffen. Für die Schilderungen des Betreuers spricht jedoch, dass Warnungen, Menschen in das erste Stockwerk zu verbringen, in der Nachbarschaft des Lebenshilfehauses nicht ausgesprochen worden sind, dessen Hauptgebäude örtlich auch nur am äußersten Rand der später vorgesehenen Warnungs- und Räumungszone lag und der Betreuer kurz nach der Warnung über deren Inhalt, wie er sie ausgesagt hat, berichtet hatte. Ungeachtet der Frage, welchen Inhalt die Warnung genau hatte, wäre auch bei Annahme des von dem Betreuer wiedergegebenen Warnungsinhalts dem in Rede stehenden Feuerwehrmann strafrechtlich kein Vorwurf zu machen, da, wie oben dargestellt, zum Zeitpunkt der Warnung noch keine Hinweise auf die später eingetretenen Umstände vorgelegen haben. Eine erneute Warnung erfolgte zu einer Zeit, die es dem Betreuer der Lebenshilfe nicht mehr ermöglichte, alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung zu retten. Vielmehr wurde er bei seinem Versuch, die Wohngruppen in den Häusern „In den Ahrwiesen“ in das Haupthaus der Einrichtung zu evakuieren, vom Wasser eingeschlossen und konnte mit einer Wohngruppe nur noch in die höheren Stockwerke ausweichen, während die im Erdgeschoss des Haupthauses lebende Wohngruppe mit einer Ausnahme von der Flutwelle getötet wurde.
VI. Verantwortlichkeit anderer Personen und Stellen
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte im Rahmen der geführten Ermittlungen fortlaufend zu prüfen, ob diese Anlass gaben, den Verfahrenskomplex auch auf andere Beschuldigte zu erstrecken. Dies hat sie auch aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz zu Recht unterlassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass, je weiter entfernt die auch für Katastrophenschutz zuständigen Stellen waren, desto schlechter ihre Kenntnislage war. Namentlich in Bezug auf die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ist darüber hinaus nicht zu erkennen, was diese konkret anderes hätte tun können als das, was sie im Rahmen ihrer Koordinationstätigkeit und der Landkreis Ahrweiler und die örtlichen Feuerwehren im Rahmen ihrer Pflicht zur Katastrophenabwehr ohnehin getan hat.
Etwas anderes gilt auch nicht im Hinblick auf eine mögliche Zuständigkeit des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Zwar sah das zum Zeitpunkt des Geschehens bestehende Katastrophenschutzrecht des Landes Rheinland-Pfalz unter bestimmten Umständen die Übernahme einer Einsatzleitung durch den Präsidenten vor. Aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft ist die Staatsanwaltschaft jedoch richtigerweise davon ausgegangen, dass diese Umstände nicht vorgelegen haben.
VII. Ergebnis
Zusammenfassend ist die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz zu dem Ergebnis gelangt, dass die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Koblenz vollständig geführt worden sind und die durch die Staatsanwaltschaft vorgenommene Bewertung der Ermittlungsergebnisse der Sach- und Rechtslage entspricht. Die gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz erhobenen Beschwerden waren daher als unbegründet zurückzuweisen.
VII. Weiteres Material
Unter „Service & Information“ auf der Homepage der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz finden Sie in der Kachel „Materialien zur Ahrtalflut“ zusätzliches Material zum Download. Hierbei handelt es sich um die bereits erwähnte, ausführliche Darlegung der für die Entscheidung maßgeblichen Rechtsfragen sowie ein FAQ zu im Verlauf des Ermittlungsverfahrens diskutierten und die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft nur am Rande betreffenden Fragen. Die Veröffentlichung des vollständigen Abschlussberichts der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz kommt aus strafverfahrensrechtlichen und datenschutzrechtlichen Gründen nicht in Betracht.
Kruse
Generalstaatsanwalt